Der Bundesgerichtshof hat in den letzten Jahren in mehreren Beschlüssen Stellung zu der Frage bezogen, welche inhaltlichen Voraussetzungen an eine Patientenverfügung zu stellen sind. Ausgangspunkt war ein Prozess, der viel Aufsehen erregte.
Eine 75-jährige Frau und Mutter von Töchtern, hatte in einer Vorsorgevollmacht einer Tochter die Gesundheitsfürsorge übertragen. Sie erlitt einen Hirnschlag und mehrere epileptische Anfälle, welche zum Verlust des gesamten Bewusstseins führten. Sie lag mittlerweile vier Jahre im Koma, konnte nicht kommunizieren und war unfähig, sich zu bewegen. Eine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins bestand nicht. Sie wurde über eine PEG–Magensonde künstlich ernährt. Obwohl keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins bestand, entschied sich die bevollmächtigte Tochter gemeinsam mit den Ärzten für die künstliche Ernährung. Eine andere Tochter lehnte die Fortsetzung der künstlichen Ernährung ihrer Mutter ab.
Die Mutter hatte in ihrer Patientenverfügung festgelegt, dass „lebensverlängernde Maßnahmen“ unterbleiben sollen, wenn medizinisch eindeutig festgestellt ist, dass keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht oder ein schwerer Dauerschaden des Gehirns zurückbleibt. Die bevollmächtigte Tochter hatte Zweifel, ob die Mutter auch die künstliche Ernährung ablehnte und entschied sich, auf Anraten der Ärzte, für die Sonde. Für eine andere Tochter stand fest, dass die Mutter keine künstliche Ernährung über eine Sonde wünschte. Es kam zum Prozess. Der Bundesgerichtshof entschied, dass die vorliegende Patientenverfügung zu unbestimmt ist. Sie reicht nicht aus, um die künstliche Ernährung einzustellen (BGH, Az.: XII ZB 61/16).
In diesem, sowie in den Beschlüssen vom 08.02.2017 (Az. XII ZB 604/15) sowie vom 14.11.2018 (Az. XII ZB 107/18) hat der Bundesgerichtshof sich mit der Frage auseinandergesetzt, welche inhaltlichen Voraussetzungen an eine Patientenverfügung zu stellen sind. Der BGH weist in diesen Entscheidungen mehrfach darauf hin, dass eine Patientenverfügung nur dann unmittelbare Bindungswirkung entfaltet, wenn ihr ganz konkrete Entscheidungen des Betroffenen über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in bestimmte, noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztlichen Maßnahmen entnommen werden können. Allein die Äußerung „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen, stelle keine konkrete und bindende Behandlungsentscheidung dar.
Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs haben zur Folge, dass eine Vielzahl von Patientenverfügungen unwirksam sind. Ganz konkret kann dies bedeuten, dass eine Person künstlich am Leben erhalten wird, obwohl sie dies auf Grund ihres Gesundheitszustandes nicht mehr möchte. Dies ist für die betroffene Person tragisch, aus ärztlicher Sicht trotzdem richtig, wenn die Patientenverfügung Zweifel offen lässt, was bei Abfassung der Verfügung tatsächlich gewollt war und ob der Verfügende sich der tödlichen Konsequenz der niedergelegten Wünsche bewusst war.
Im dem vom Bundesgerichtshof zu entscheidenden Fall ergaben sich folgende Fragen: Wusste die Frau bei der Abfassung der Patientenverfügung was sie tatsächlich schrieb? War ihr klar, dass ein Plastikschlauch in ihrem Magen einmal eine „lebensverlängernde Maßnahme“ ist und somit über Leben und Tod entscheidet? Die Antwort des Bundesgerichtshofes lautete: Man weiß es nicht.
Spätestens seit den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs steht fest, dass Patientenverfügungen nur dann eine Bindungswirkung entfalten, wenn ihr konkrete Entscheidungen des Betroffenen über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in bestimmte, noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen entnommen werden können. Allein die Äußerung „keine lebenserhaltende Maßnahmen“ zu wünschen, sind nicht hinreichend konkret genug und stellen keine Behandlungsentscheidung dar. Die erforderliche Konkretisierung muss durch die Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen oder die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen erfolgen. Im obig beschriebenen Fall hätte die Patientenverfügung beispielhaften den Passus enthalten müssen: „Ich lehne jede Sonderkost ab, wenn ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals wieder auf diese werde verzichten können. Ich weiß, dass diese Entscheidung mein Tod bedeutet bzw. bedeuten kann.“
Solche konkreten Aufzählungen einzelner Situationen und Maßnahmen sind sehr mühsam und umfangreich. Sie sind für medizinische Laien ohne Hilfe in der Regel nicht möglich. Ungeachtet dessen sind sie spätestens seit den Gerichtsentscheidungen ohne Alternative, denn der Wille des Betroffenen muss unmissverständlich sein. Da es Laien so gut wie unmöglich ist, die Krankheitszustände und die gewünschten oder abgelehnten Behandlungen medizinisch eindeutig zu formulieren, empfiehlt sich eine Beratung durch den Arzt des Vertrauens.
Formale Anforderungen an eine Patientenverfügung stellt das Gesetz nur wenige. Die Patientenverfügung muss in Schriftform vorliegen und eigenhändig unterschrieben sein. Der Verfasser muss volljährig und einwilligungsfähig sein. In Buchhandlungen sowie im Internet findet man eine Vielzahl von Musterformularen. Nur einige davon sind wirklich gut und entsprechen den Anforderungen des Bundesgerichtshofs. Wir empfehlen daher im Falle einer schweren Erkrankung die Behandlungswünsche gemeinsam mit dem Arzt und einem Juristen in einer speziellen Patientenverfügung festzulegen.
In der Patientenverfügung ist eine Person zu benennen, die die niedergelegten Wünsche im Ernstfall auch durchsetzt. Die Wahl ist gut zu überlegen, da nicht jeder in der Lage ist, die emotionale Last und Verantwortung für den endgültigen Tod eines nahestehenden Menschen zu tragen. Es empfiehlt sich, mit der Person im Vorfeld über die eigenen Wünsche und Vorstellungen zu sprechen.
Simone Mainda, Rechtsanwältin H&P Rechtsanwälte
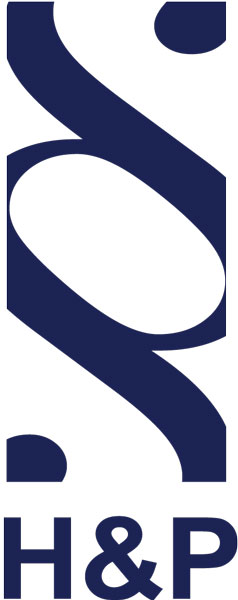
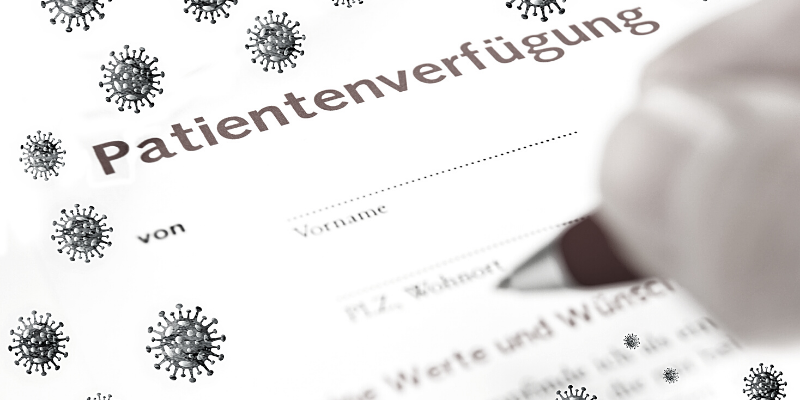
Neueste Kommentare